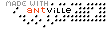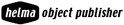1. Vision von einer Kultur des Friedens
Kennen Sie eine Gesellschaft, die ohne Gewalt existiert hat oder heute existiert?
Wenn ich in unsere Geschichtsbücher schaue, lese ich ständig von Kriegen, Machtwechseln, militärischen Kämpfen, Siegen und Niederlagen. Und meistens wird dabei von Männern erzählt. Zur Menschheitsgeschichte scheint Gewalt in den unterschiedlichsten Formen immer dazu zu gehören.
Allerdings ist mir auch keine Friedens-Geschichtsschreibung bekannt. Da müßten die Schwachen und Ohnmächtigen, die Frauen und die Randgruppen der Gesellschaft im Mittelpunkt stehen. Wie, so frage ich mich, würde da unser 20. Jahrhundert dargestellt sein?
Hat bei dieser Realität eine Kultur des Friedens überhaupt eine Chance oder bleiben es nur schöne Wünsche und große Worte, wenn wir uns heute hier zusammen setzen unter dem Thema, eine Kultur des Friedens aufbauen zu wollen?
So, wie die Menschen für Gewalt und Kriege verantwortlich sind, gilt dies ebenso für den Frieden. Mehr Geld, Phantasie, Kraft und Kreativität könnten dafür noch eingesetzt werden. Denn, der Frieden muß immer wieder neu erkämpft werden. Er ist kein Gut, was einmal erreicht, nie wieder verloren gehen kann.
Lassen Sie uns zuerst überlegen, was wir unter Frieden überhaupt verstehen.
Frieden ist für uns die Abwesenheit des Krieges und das Schweigen der Waffen. Nach dieser Definition leben wir hier in Deutschland seit 1945 im Frieden.
Eine Kultur des Friedens zu leben bedeutet aber mehr.
Für manche ist Frieden Harmonie in den zwischenmenschlichen Beziehungen und Abwesenheit von Konflikten.. Dabei werden häufig aus Angst Konflikte verdrängt oder geleugnet. Ich bin fest davon überzeugt, daß Konflikt nicht nur in unserem Leben sind, sondern wir sie auch zur eigenen Entfaltung brauchen. Andernfalls würden wir in unserer Entwicklung stagnieren. Denn bei jedem Konflikt wird unsere Entscheidung gefordert und gleichzeitig neue Chancen sichtbar.
Also nicht der Konflikt an und für sich verbindet sich mit Gewalt. Sondern die Art und Weise ihn zu lösen macht sichtbar, wie friedlich wir leben und selbst sind.
Nach den Friedenspädagogen Uli Jäger und Günther Gugel stellt sich Frieden als ein:
„zielgerichteter Prozeß dar, in dem es darauf ankommt, daß Menschen mit ihrem Engagement versuchen, Konflikte mit gewaltfreien Mitteln auszutragen und dabei Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und Demokratie zunehmend zu verwirklichen.“
Danach hat Frieden etwas mit Visionen und Engagement zu tun.
Frieden ist also kein Ziel, sondern ein Prozeß oder der Weg dorthin, wie Mahatma Gandhi es gesagt hat.
2. Kultur des Friedens beginnt in den Köpfen
Obwohl es uns leichter fällt und mehr Aufmerksamkeit bewirkt, wenn wir über Gewalttaten reden, sollten wir ganz bewußt den Frieden in den Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns stellen.
1945, kurz nach dem 2. Weltkrieg, wurde die Präambel der UNESCO-Verfassung geschrieben. Darin heißt es:
„Da Krieg in den Köpfen der Menschen beginnt, muß in den Köpfen der Menschen Vorsorge für den Frieden getroffen werden“
Laßt uns dies aufgreifen und in den Köpfen beginnen, aber wie?
Realistisch müssen wir wahrnehmen, daß es heute sehr schwer ist, Menschen für aktives Friedensengagement zu gewinnen. Solange sie selbst nicht bedroht oder persönlich betroffen sind, bleibt dafür kaum Zeit. Um uns vor größeren Enttäuschungen zu schützen, sollten wir deshalb auch realistische, kleine Schritte gehen. Dabei heißt das Ziel, Gewalt in unserer Gesellschaft zu minimieren.
Nachfolgend möchte ich fünf mögliche Punkte benennen.
2.1. Sensibel werden für Gewaltformen
Wir müssen sensibel und wach werden für die vielfältigen Formen von Gewalt in unserem Alltag.
2.2. Gewalt auch als Gewalt benennen
Es reicht nicht aus, Gewalt nur wahrzunehmen, sondern wir müssen sie auch deutlich als solche benennen. Dazu gehört es eventuell auch, traditionell gewachsene Tabus zu brechen.
2.3. Öffentliche Gewaltdarstellung kritisch wahrnehmen
Es geht nicht darum, Gewalt zu verharmlosen. Wir müssen uns aber kritisch mit Überbewertung oder Überhöhung von Gewaltakten in der öffentlichen Berichterstattung, z.B. Fernsehen oder Tageszeitung auseinandersetzen. Sonst besteht die Gefahr, daß individuelle Ängste verstärkt werden und Gewaltdrohungen verspürt werden, wo sie eventuell gar keine sind.
2.4. Bewußt Alternativen zu Gewalt suchen
Unsere Bereitschaft, wirklich etwas ändern zu wollen ist nötig,. Eine Kultur des Friedens aufzubauen braucht aber auch Vorbilder. So dürfen wir es nicht dulden, daß nur die gewaltvollen Taten in der Erinnerung fortleben, während die friedlichen Erfahrungen all zu schnell in Vergessenheit geraten.
2.5. Individuelles und politisches Handeln
Sicher kann ich im Kleinen, aus meiner persönlichen Betroffenheit heraus friedensengagiert tätig werden. Aber das wird bald ermüden, wenn daraus nicht auch ein politisches Handeln, gemeinsam mit anderen folgt.
3. Gewalterfahrungen gehören zum Alltag
Spätestens jetzt ist es nötig, uns über die vielfältigen Gewaltdefinitionen zu verständigen. Wenn wir von Gewalt reden, meinen mir meist etwas Negatives. Die legitimen Gewaltformen von Polizei oder Armee, eingesetzt zur Aufrechterhaltung einer allgemein gültigen Ordnung, werden dabei häufig ausgeblendet.
Bei Gewalt denken wir zuerst an die physische oder direkte Gewalt. Dabei sind die Folgen bei den betroffenen Personen als Körperverletzung bis zu Todesfolgen sichtbar. Täter und Opfer sind als Individuen erkennbar.
Es gibt aber auch Gewalt, die sich in psychischer Form zeigt und deren Folgen nicht so eindeutig einer Handlung zuzuordnen sind. Manchmal treten diese auch viel später auf. Die Opfer sind nicht mehr so direkt erkennbar und haben es letztlich auch schwerer, die gegen sie ausgeübte Gewalt öffentlich nachvollziehbar zu machen.
Solange der Täter aber noch bekannt ist, gehört auch diese Form zur personellen Gewalt. Nach Johan Galtung, einem norwegischen Friedensforscher, werden bei diesen Definitionen all die Gewaltformen nicht erfaßt, die Opfer, aber keine klar erkennbaren Täter haben.
Diese nennt er strukturelle Gewalt. Nach seiner Definition liegt sie dann vor, „wenn Menschen so beeinflußt werden, daß sie sich nicht so entwickeln können, wie dies eigentlich unter den gegebenen Umständen möglich wäre.“ Bei diesem weiter gefaßten Gewaltbegriff werden auch die gewaltverursachenden ungerechten Strukturen einer Gesellschaft mit einbezogen. Diese Überlegungen haben Galtung viel Kritik eingebracht, da er von einem sehr umfassenden Gewaltverständnis ausgeht. Anderseits löste die Herstellung von Zusammenhängen zwischen Gewalt und Ungerechtigkeit auch berechtigte Ängste bei den Verursachern aus.
Sich bei Gewalt nicht nur mit den sichtbaren Formen abzufinden, ließ Galtung auch noch die Kategorie der kulturellen Gewalt einführen, die er als Legitimation für strukturelle oder direkte Gewalt versteht.
Das Gewalt unweigerlich mit Herrschaftstreben und Verlust von Macht zusammenhängt, drückt Iräneus Eibl-Eibesfeldt: in seiner Definition aus. Danach versteht er Gewalt als eine Form des Dominazverhaltens und des gewaltsamen Erzwingens einer Dominazposition.
Aber auch die Überlegungen von Thea Bauriedl, einer Pschoanalytikerin, möchte ich noch anfügen: „Gewalt können wir heute aus meiner Sicht...nicht mehr als Ausdruck eines Aggressionstriebes und auch nicht als Ausdruck des ewigen Widerspruchs zwischen Individuum und Gesellschaft verstehen. Als neue, kreative Alternative stellt sich für mich das Verständnis von Gewalt als Ausdruck einer gestörten Beziehung oder gestörter, destruktiver Beziehungsphantasien dar.“ (aus: Bauriedl, Thea (1992): Wege aus der Gewalt, Freiburg)
Bei allen Überlegungen wird deutlich, daß Gewalt immer als Form von schneller Konfliktlösung, aber auch als Reaktion auf eigene Gewalt- und Ohnmachtserfahrungen eingesetzt wird. Allerdings löst Gewalt ständig wieder Gewalt aus. Es ergibt sich daraus ein Gewaltenkreislauf. Will man Gewalt minimieren, muß dieser durchbrochen werden.
Sich bewußt mit Alternativen zu Gewalt zu beschäftigen, setzt aber auch voraus, unsere eigene Gewalttätigkeit zu kennen. Wir müssen uns fragen, wie wir selbst mit Gewalt umgehen und wo und wie weit wir sie auch als Mittel akzeptieren können.
Nach diesen Vorüberlegungen, die deutlich machen, wie vielfältig die Definition für Gewalt verstanden wird, will ich Sie an vier Beispielen sensibel für Gewalt in unserer Gesellschaft machen.
Dabei greife ich Erfahrungen auf, die in den anschließenden Arbeitsgruppen weiter verfolgt werden können.
Kinder und Jugendliche
Gewalt verbinden wir meist zuerst mit Kindern und Jugendlichen. Sicher tritt sie auch bei dieser Gruppe am deutlichsten zutage, aber was steckt dahinter? Ich möchte Ihnen die Geschichte von Michael K erzählen. Er ist 16 Jahre alt und als farbiges Kind bei Adoptiveltern im Vogtland aufgewachsen. Nach mehreren Androhungen wird er in der 10. Klasse offiziell aus dem Gymnasium ausgeschlossen. Sein Verhalten läßt sich nicht mehr mit der Schulordnung in Einklang bringen. Mehrmals hat er Morddrohungen in Briefen an verschiedene Lehrer geschrieben, die nach dem Lehrerinnen-Mord von Meissen nicht mehr unbeachtet bleiben konnten. Außerdem konnte ihm nachgewiesen werden, sich in einer verbotenen Satanismus- Vereinigung zu engagieren. Als er den Ernst des Schulausschlusses wahrnimmt, begeht er einen Selbstmordversuch, indem er sich die Pulsader aufschneidet. Umbringen wollte er sich nach seinen Aussagen nicht, sondern nur auf sich aufmerksam machen.
Was ist in diesem Leben schon alles abgelaufen, um zu solchen Taten fähig zu sein?
Soziales
Edith S., eine Frau von 50.
Zu DDR-Zeiten leitete sie eine Verkaufsstelle der HO. Trotz zwei kleiner Kinder hatte sie sich über Frauensonderstudium qualifiziert. 1991 wurde die Geschäftsstelle geschlossen. Edith erhielt eine kleine Abfindung und ging zum Arbeitsamt, in der Hoffnung eine neue Tätigkeit vermittelt zu bekommen. Dort sagte man ihr aber nur „Sie sind zu alt“. Nun blieb für sie nur Langzeitarbeitslosigkeit, ABM und Aktion 55 bei verringertem Einkommen oder einfach Hausfrau-Dasein übrig. Als ihr Mann auch noch arbeitslos wurde, fürchtete sie sich vor dem drohenden materiellen Abstieg. Kurz nach der Wende hatte sich die Familie eine neue Küche gekauft, die noch nicht abgezahlt war. Plötzlich war Edith vom zunehmenden Wohlstand im Land abgeschnitten und fiel langsam in die soziale Isolation. Dazu fehlte ihr die gesellschaftliche Anerkennung, die sie in den Jahren davor in ihrem Betriebskollektiv erhalten hatte. Arbeitslosigkeit war für sie nichts zeitlich begrenztes mehr. Es wurde ein Dauerzustand in die langsame Armut. Auch bei den Behörden fand sie wenig Verständnis, sondern nur barsche Antworten auf ihre unsicheren Fragen. Sie schämte sich, eine ständige Bittstellerin zu sein und zog sich aus der Gesellschaft immer mehr zurück.
Frau und Mann
Maria L., Pfarrfrau, Anfang Fünfzig
Nach einer Kirchenversammlung kam ihr Mann nach Hause. Wie schon so oft in den zurückliegenden Jahren, gibt er ihr die Schuld für alle Kritik, die er in dieser Versammlung erfahren musste. Er beleidigt seine Frau und droht, sie zu schlagen. In seinem Zorn beginnt er sie sogar zu würgen, fügt ihr mit dem Schraubenzieher tiefe Wunden in der Brust zu. Zum Schluß vergewaltigt er sie mit den Worten: „Du bist meine Frau und ich verlange meine Rechte!“
Am nächsten Morgen, einem Sonntag, muß sie ihm seine Kleider bügeln und mit ihm in die Kirche gehen. Dort, so verlangt ihr Mann, soll sie um Vergebung beten, weil sie eine so schlechte Ehefrau sei.
14 Jahre lang hat sie diese Qualen mitgemacht, bis sie endlich ihre Familie verließ. Die Gemeinde wußte nichts davon und innerhalb der Kirche fand sie auch bei niemanden soviel Vertrauen, um von ihrer Not zu erzählen.
Gewinner und Verlierer
Wolfgang T., End-Vierziger, Pfarrerssohn
In der DDR trat er bewußter in die SED ein, um seiner Kariere nicht zu schaden. Als Diplom-Ingenieur arbeitet er in einem Großbetrieb. Nach der Wende wurde die ganze Abteilung abwickelte und er war arbeitslos, aber nicht pessimistisch. Wie so manche wurde er Versicherungsvertreter und Unternehmensberater. Nach mehreren Monaten brach er von sich aus ab. Er konnte es nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren ständig andere Menschen hinters Licht zu führen, um eigenen Gewinn zu erzielen. Wieder war er arbeitslos. Dann verschuldete er sich hoch, um für seinen neue Berufstätigkeit einen eigenen Kleinbus kaufen zu können. Damit reiste Wolfgang kreuz und quer durch Deutschland und kaufte billig Kleidung auf. In anderen Teilen des Landes verkaufte er sie, frisch von ihm gebügelt, wieder. Lange ging auch dieses Geschäft nicht gut. Bald war er wieder ohne Arbeit und diesmal mit vielen Schulden belastet. Die nächste Berufstätigkeit endete mit der Pleite des neuen Betriebes.
Er wollte aber nicht unterliegen und forderte beim Arbeitsamt, auch wenn er dafür eigentlich schon zu alt wäre, einen Weiterbildungskurs als Informatiker ein. Dieses Jahr lohnte sich für ihn. Anschließend fand er in München eine Firma, die ihn mit seinem neuen Beruf einstellte. Sein Engagement und seine Flexibilität hatten sich gelohnt.
4. Hinderungsgründe, eine Kultur des Friedens aufzubauen
Die Beispiele zeigen, daß eine Veränderung hin zu einer Kultur des Friedens in unserer Gesellschaft nötig ist. Was macht es uns aber so schwer? Lassen Sie mich einige Punkte anreißen.
4.1. Unser Bedürfnis nach Sicherheit und fehlender Risikobereitschaft
Der zunehmende Wohlstand in der Bundesrepublik Deutschland hat über viele Jahrzehnte Lebensmodelle alltäglich werden lassen, in denen Erwerbsarbeit oder Besitz zu einer ständigen Vermehrung des Eigenkapitals führten und eine Sicherheit vorgaugelten. War die Berufstätigkeit beenden, sorgten Lebensversicherungen, Pensionen oder Renten für einen „gesicherten Lebensabend“. Auch wenn dieses ein Auslaufmodell für uns Ostdeutschen wird, bestimmt es doch zumindest unser Wunschdenken.
Die vielfältigen Versicherungsangebote vermitteln uns dazu noch immer das Gefühl, wir könnten uns gegen alles absichern, gegen Diebstahl, Unfall, gar Naturkatastrophen. Was nicht in diese Kategorie fällt, wird uns empfohlen, sollte wegen des unvorhersehbaren Risikos lieber unterlassen werden. Dazu kommt, daß wir aus DDR-Zeiten gewöhnt waren, daß andere, „die da oben“, für uns und über uns entschieden haben.
Leider sind Vorbilder für Risikobereitschaft häufig skrupellose wirtschaftliche Machenschaften und moralisch verwerflich, s. Baulöwe Schneider in Leipzig. Erst bekommt er Kredite, dann folgt der Ruin und Millionenschulden. Wo andere ihre gerechte Strafe erhalten, kauft er sich frei und erhält jetzt sogar noch mit seiner Autobiografie öffentliche Anerkennung.
Jeder einzelne von uns muß sich selbst fragen, wie sehr dieses Denken auch sein Handeln gegen Gewalt bestimmt.
4.2. unsere Scheu vor Konflikten
Harmoniebedürfnis und falsch verstandenes Konfliktverständnis läßt uns, gerade in christlichen Haushalten, schnell die wirklichen Konflikte zudecken, verlagern oder negieren. Immer wieder setzen wir Konflikt mit Gewalt gleich. Wir wundern uns, wenn ein lange schwellender Konflikt plötzlich bösartig ausbricht. Außerdem könnte die Bearbeitung zuviel Zeit von uns verlangen, die wir im Moment nicht haben.
4.3. zunehmende Sprachlosigkeit in den Beziehungen
Ermöglicht die Informationsgesellschaft einerseits einen breiteren und schnelleren Zugang zu umfassenden Informationen weltweit, führt anderseits die einseitige Beschäftigung mit den modernen Medien auch zu einer Vereinsamung. Übungsfelder zum Erlernen von fairer, individueller Kommunikation über unsere Sprache nehmen ab. Besonders kraß zeigt sich diese Sprachlosigkeit in Familien, wo ständig der Fernseher den Tagesablauf bestimmt. Man sitzt wohl noch nebeneinander, hat sich aber nichts mehr zu sagen.
4.4. Verlust an Einfühlungsvermögen
In unserer Konsumgesellschaft müssen wir uns ständig wieder fragen, welchen Stellenwert der Mensch noch besitzt. Die Kultur des Friedens baut darauf auf, daß ich mich selbst als Mensch auch mit meinen Fehlern annehme und in meinem Gegenüber, auch wenn es mein Feind ist, trotzdem noch das Ebenbild Gottes mit menschlichem Antlitz wahrnehme. Ideologien bedienen sich aus Angst oder Strategie Feindbildern, die Menschen entwürdigen und so schneller ihrer Vernichtung preis geben.
In der virtuellen Welt der Computerspiele können ihre Benutzer ganze Nationen oder Erdteile per Maus-clic ausrotten. Sie haben zu dieser unwirklichen Welt keine menschliche Beziehung aufgebaut. Wenn diese Spieler keine Möglichkeit bekommen, sich auch in der Welt der Opfer, der Geschlagenen, der Unterdrückten einzufühlen, wird ihre Empathie verkümmern. Auch in der realen Welt werden sie als Folge ohne Skrupel Gewalt anwenden.
Lassen Sie mich mit einer Geschichte des polnischen Schriftstellers Stefan Chwin enden. Er stellt dieser Tendenz das christliche Caritas-Prinzip entgegen und beschreibt es als historisches Erbe der Völker Mitteleuropas. An einem Erlebnis seiner Mutter erklärt er dies. Als Krankenschwester beim Warschauer Aufstand 1944 mußte sie erleben, wie Deutsche skrupellos Ärzte, Schwestern und Patienten ermordeten. Darauf schwor sie sich, keinen Deutschen in ihrer Nähe überleben zu lassen. Den ersten den sie danach traf, war ein blutender deutscher Soldat, der hilflos vor ihr auf der Straße lag. Anstatt ihn zu ermorden verband sie seine Wunden. Für sie lag da nicht der Feind, sondern ein schwacher Mensch, der ihre Hilfe benötigte. Soweit Chwim.
Mein persönlicher Wunsch wäre es, eine Kultur des Friedens aufzubauen, die damit beginnt in und vor Gewaltsituationen von der hilflosen Sprachlosigkeit zum beginnenden Stottern und Handeln zu gelangen.
Last update: 11/5/11, 10:03 AM
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| August | ||||||
wahre Leben ist das Leben, sondern das, was deine Anwesenheit...